1842 |
Wie überall
im Lande, fanden sich auch in unserer Gemeinde Männer aller
Altersklassen zusammen und gründeten im Jahre 1842 den "Männergesangverein
1842", mit dem schönen Ziel, gemeinsam dem deutschen Lied
nach Kräften zu dienen. Der Gesangverein zählte 27 aktive
Mitglieder:
Johannes Ambach, Joseph Frisch, Johannes Lohrum,
Konrad Seibert, Anton Schlüssel, Philipp Schwarz, Konrad Sieben,
Michael Stenner, Johannes Stohr, Jakob und Michael Horn, Philipp
Instadt, Bernhard Müller, Valentin Rögner, Heinrich Schlüssel,
Jakob Seibert, Jakob Sieben III, Michael Becker, Anton Fuchs, Bartholome
Horn, Philipp Kerz, Friedrich Müller, Philipp Stamm, Konrad
Becker, Karl Eberhard, Rudolf Schwarz und Georg Stang. Gründungspräsident
war Dr. Rudolph Schwarz, prakt. Arzt, Brennereibesitzer und von
1848 bis 1853 Bürgermeister in Nieder-Olm. Initiator für
die Vereinsgründung war der katholische Pfarrer, Dekan Peter
Anton Greipp (1833 bis 1858) in Nieder-Olm, dessen Grab sich heute
noch auf dem Nieder-Olmer Friedhof befindet. Erster Dirigent
war Lehrer Andreas Holzamer aus Heusenstamm (Großvater
des späteren Nieder-Olmer Heimatdichters Wilhelm Holzamer),
der 1842 die frei gewordene Stelle von Lehrer Kügel an der
Nieder-Olmer Schule übernommen hatte und auch Organist an der
kath. Pfarrkirche war.
Diesen ehrbaren Männern gilt noch
heute unser Dank. |
HEIMAT UND HERKUNFT
Die
Familie Holzamer kann man nicht als eine alte rheinhessische Familie
bezeichnen, wenn man die Spuren verfolgt, die sie in der rheinhessischen
Gemeinde Nieder-Olm, dreizehn Kilometer südwestlich von Mainz,
hinterlassen hat. Auch der Name Holzamer, dessen Etymologie schwankend
ist, kommt sonst nicht im linksrheinischen hessisch-pfälzischen
Raum vor. Die Holzamer sind Zugewanderte. Nicht ganz hundert Jahre
lang haben sie Heimat in Nieder-Olm gehabt; danach findet man ihre
direkten Nachkommen in die rheinhessischen Randgebiete (Bingen,
Oppenheim, Worms) und über den ganzen deutschen Raum, ja bis
ins Ausland, nach Frankreich und Nordamerika, verstreut. In Nieder-Olm
lebt heute kein Mitglied der Familie Holzamer mehr.
Aber
gerade in dieser Gemeinde, die an der Pulsader des rheinhessischen
Raumes, an der Pariser Straße, gelegen ist, haben die Holzamer
jenen Aufstieg begonnen, der ihrem Namen Bedeutung und Ansehen verliehen
hat. Freilich handelt es sich dabei nur um einen Ast der an sieh
größeren Gesamtfamilie, -- doch wiederum um jenen, dessen
Herkommen aus dem rheinfränkischen Volkstum durch die Erscheinung
des Dichters Wilhelm Holzamer am deutlichsten zu belegen ist.
Die Persönlichkeit des Andreas Holzamer (Großvater
von Wilhelm Holzamer):
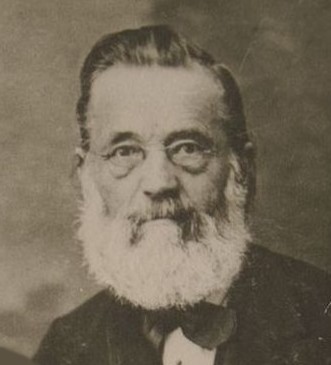 Der
Lehrer Andreas Holzamer, den wir hier im Hinblick auf den Dichter
Wilhelm Holzamer als den Ahn der Familie bezeichnen wollen, ist
am 1. August 1805 noch in Heusenstamm (Kreis Offenbach am Main)
als Sohn eines dort ansässigen Landwirts geboren. Er kam im
Jahre 1834 nach Rheinhessen, als er die katholische Lehrerstelle
in Osthofen (Kreis Worms) antrat. Sieben Jahre später, am 1.
November 1842 wurde er an die zweiklassig gewordene Volksschule
in Nieder-Olm versetzt, und hier beginnt seine Persönlichkeit
über das Einwirken auf seinen Enkel Wilhelm hinaus für
uns greifbar zu werden. -- Andreas Holzamer war nämlich, als
er nach Nieder-Olm kam, bereits das, was man in der historischen
Zeitspanne zwischen dem Hambacher Fest und dem Wirken der Frankfurter
Nationalversammlung "demokratisch eingestallt" zu nennen
pflegte. Der
Lehrer Andreas Holzamer, den wir hier im Hinblick auf den Dichter
Wilhelm Holzamer als den Ahn der Familie bezeichnen wollen, ist
am 1. August 1805 noch in Heusenstamm (Kreis Offenbach am Main)
als Sohn eines dort ansässigen Landwirts geboren. Er kam im
Jahre 1834 nach Rheinhessen, als er die katholische Lehrerstelle
in Osthofen (Kreis Worms) antrat. Sieben Jahre später, am 1.
November 1842 wurde er an die zweiklassig gewordene Volksschule
in Nieder-Olm versetzt, und hier beginnt seine Persönlichkeit
über das Einwirken auf seinen Enkel Wilhelm hinaus für
uns greifbar zu werden. -- Andreas Holzamer war nämlich, als
er nach Nieder-Olm kam, bereits das, was man in der historischen
Zeitspanne zwischen dem Hambacher Fest und dem Wirken der Frankfurter
Nationalversammlung "demokratisch eingestallt" zu nennen
pflegte.
Er trat für die revolutionären
Gedanken der Bundesreform ein und verfocht leidenschaftlich die
Idee der Herauslösung der Volksschule aus der kirchlichen Oberaufsicht.
Dieser primäre Gedanke erweiterte sich ihm im Laufe der Zeit,
auch über die Revolutionsjahre von 1848/1849 hinaus, immer
mehr zu der allgemeinen Forderung nach Erneuerung von Würde
und Unabhängigkeit des Lehrerstandes. Er stand mit dieser Ansicht
zwar nicht allein, denn viele andere, so auch der vor ihm in Nieder-Olm
tätig gewesene Lehrer und spätere Landtagsabgeordnete
Paulsackel, vertraten die gleichen Forderungen. Aber innerhalb der
Dorfgemeinschaft wurde der Lehrer Andreas Holzamer, der seine Ansichten
in Denkschriften an das Ministerium in Darmstadt niederlegte, im
Zuge der Reaktion bald als "Heidenlehrer" nach der Formel
"Demokrat = Kirchenfeind" bezeichnet. Außerdem bezog
sich die demokratische Presse bei ihren Kommentaren öfter auf
sein Beispiel und veröffentlichte die Eingaben, die er dem
großherzoglichen Ministerium unterbreitet hatte. Freilich,
der Lehrer Holzamer hielt keinen orthodoxen Religionsunterricht,
denn er war selbst zur "freireligiösen" Auffassung
durchgedrungen; aber er blieb eine vornehme, offene und jedenfalls
auch tolerante Persönlichkeit, begabt mit einem außergewöhnlichen
pädagogischen Talent, das ihm die Liebe und die Anhänglichkeit
seiner Schüler gewann. Er war leidenschaftlich der Musik ergeben
und als Inhaber der ersten Nieder-OImer Lehrerstelle auch zum Organistendienst
in der katholischen Pfarrkirche rechtlich verpflichtet. Sowohl die
Leitung des Gesangvereins, der wiederum, weil Holzamer der Dirigent
war, "Demokratenverein" genannt wurde, als auch das Amt
des Organisten versah er jahrelang mustergültig und pflichtbewusst.
Mühsam erkämpfte er sich das Ansehen unter den Dorfbewohnern.
Er hat es später nicht mehr verloren, auch als er seinen Dienst
als Lehrer quittieren musste.
Im Jahre 1860 fanden
die ständigen Kontroversen mit der Kirchenobrigkeit wider den
Willen des Lehrers Andreas Holzamer ihr Ende durch das Eingreifen
des Mainzer Bischofs Wilhelm Emanuel von Ketteler, der die zwangsweise
Pensionierung des 48er-Revolutionärs Holzamer erwirkte. Zwei
Jahre zuvor hatte die Gemeinde Nieder-Olm noch beschlossen, Holzamer
das Organistengehalt zu erhöhen. Dieser Beschluss ist aber,
weil er von der Kirchenobrigkeit nicht genehmigt wurde, nie wirksam
geworden. Aus dieser Tatsache wird klar ersichtlich, dass Holzamer
sich einerseits eines ungeschmälerten Ansehens auch als "Demokrat"
erfreuen durfte, dass andererseits sein persönliches Schicksal
aber eng an die Differenzen gebunden blieb, die er aus idealer Gesinnung
mit den herrschenden Regierungsgewalten heraufbeschworen hatte.
Durch die zwangsweise Pensionierung in ernste wirtschaftliche Schwierigkeiten
gebracht, gründete Andreas Holzamer in Nieder-Olm eine Privatschule,
um daraus die Mittel für den Unterhalt seiner großen
Familie zu gewinnen. Neun Kinder waren ihm in der Zeit zwischen
1842 und 1858 geboren worden, davon starben drei sehr früh.
Der älteste, der am 6. 6. 1842 in Oppenheim geborene Sohn Heinrich
Georg Josef Holzamer, ist der Vater des Dichters Wilhelm Holzamer.
Die Nieder-Olmer Privatschule erfreute sich bald eines
blühenden Lebens. In den dreiundzwanzig Jahren ihres Bestehens
hat sie sich unter der Leitung ihres kraftvollen, gebildeten und
den modernen Zeitaufgaben zugewandten Lehrers um die Heranbildung
der geistig aufgeschlossenen Jugend auch in den Nieder-Olm umgebenden
Orten verdient gemacht. Sie galt als das Sprungbrett zur Mainzer
Realschule, denn Andreas Holzamer lehrte bereits in den ersten Klassen
die französische Sprache. Auch diese Tatsache muss als ein
Erbe der 48er Jahre bei Andreas Holzamer angesehen werden, denn
die Hinwendung zu dem ebenfalls revolutionären Frankreich zeichnet
namentlich die 48er-Revolutionäre in Baden und im hessisch-pfälzischen
Räume aus. Zum andern dürfte das Wertgefühl für
eine Fremdsprache auch aus dem idealistischen Sinn der deutschen
Demokraten von Hambach zu verstehen sein, welche die Einheit Deutschlands
als Volkssouveränität bei gleichzeitiger Verbrüderung
der Völker anstrebten. Offenbar wirkte der starke internationale
Zug der frühen pfälzischen Revolutionsbewegung in diesem
Fremdsprachenbedürfnis des Lehrers Holzamer nach.
Die
Schüler von Holzamers Privatschule setzten sich zum großen
Teil aus Anwärtern auf die höhere Schule zusammen. Fast
alle Kinder der in der Nähe wohnenden jüdischen Händler
und Kaufleute erfuhren dort ihre geistige Erziehung, wobei für
die jüdischen Eltern die Tatsache der absoluten religiösen
Toleranz in Holzamers Schulerziehung entscheidend gewesen sein mag.
Aber dem "alten Holzamer", wie ihn die Leute bald nannten,
da er in ihren Augen doch Herr über sein Schicksal geworden
war, eignete auch ein starker sozialer Zug, der seinen Ausdruck
darin fand, dass er trotz seiner finanziellen Notlage den Kindern
Minderbemittelter, wenn sie nur Begabung zeigten, den freien Eintritt
in seine Schule nicht verwehrte.
Auf Grund dieser
Zeugnisse darf man den Lehrer Andreas Holzamer als einen für
seine Zeit modernen, fortschrittlichen Menschen, als einen aufrechten,
unbestechlichen Charakter und als einen über das übliche
Niveau hinaus gebildeten und wegweisenden Pädagogen bezeichnen.
Obwohl er keinen Nachfolger hat finden können, und so die Bezirke
seines Wirkens relativ klein blieben, ist er in unserem Zusammenhang
besonders wichtig, weil ihm als Großvater des Dichters Wilhelm
Holzamer ein wesentliches Verdienst an dessen geistiger Durchbildung
seit der frühesten Jugend zukommt. Alle Keime, die der alte
Lehrer in seinem Enkel- und Patenkind Wilhelm Andreas bis zu dessen
dreizehntem Lebensjahre hüten und pflegen konnte, ehe er überraschend
im Jahre 1883 starb, sind später prächtig aufgegangen
und haben in den Dichtungen Wilhelm Holzamers während aller
Schaffensperioden leuchtende Blüten getrieben. Der Dichter
aber hat das Andenken an den Ahn der rheinhessischen Holzamer immer
in hohen Ehren gehalten, und er ist nicht müde geworden, immer
wieder zu unterstreichen, welche wertvollen Voraussetzungen für
sein Werk ihm der Großvater mit seinem lauteren Menschentum
geschaffen hat.
(Quelle: Auszug aus der Dissertation von
Günter Heinemann, Nieder-Olm, 1956)
|
1846 |
Mit großer
Begeisterung gingen die Sänger ans Werk und beteiligten sich
schon nach vier Jahren, am 8. Juni 1846, mit dem "Nocturno"
von Blum und dem "Studentengruß" von Berner am "Wettsingen
rheinhessischer Gesangvereine" in der Mainzer Fruchthalle.
Sie bekamen von den drei Wertungsrichtern, Kapellmeister Suhr aus
Frankfurt, Vincenz Lachner aus Mannheim und Hofkapellmeister W.
Mangold aus Darmstadt den 3. Preis, eine Silbermedaille, zugesprochen.
Diese erste Medaille wird seitdem im Vereinsarchiv hoch in Ehren
gehalten, ist sie doch der älteste Nachweis der Frühaktivitäten
des jungen Männergesangvereins.
Intelligenzblatt für den Landkreis Mainz,
Samstag, den 13. Juni 1846:
Wettgesang
rheinhessischer Singvereine in Mainz den 8. Juni 1846
"....Vier Preise waren ausgestellt,
zwei goldene und zwei silberne Medaillen von verschiedenem Werthe:
wer dieselben bekommen sollte, darüber schien am Schlusse bei
allen Anwesenden fast nur eine Stimme zu herrschen; nur über
den Rang der vier besten Vereine war man nicht vollkommen übereinstimmend,
und sah deshalb mit Spannung der Entscheidung der Herren Preisrichter
entgegen. Diese - die Herren Kapellmeister Suhr von Frankfurt, Vincenz
Lachner von Mannheim, und Hofkapellmeister W Mangold von Dannstadt
- thaten den Ausspruch: "Den ersten Preis erhält der Verein
zu Castel (unter der Leitung des Herrn A. Werner), den zweiten Preis
der von Oppenheim (unter der Leitung des Herrn W Jost), den dritten
der von Nieder-Olm (unter der Leitung des Herrn A. Holzamer), den
vierten der von Ebersheim (unter der Leitung des Herrn Gumbel)....
Der rheinische Telegraf, Jahrg. 8, Sonntag,
den 14. Juni 1846, S. 184:
Feuilleton
des Einheimischen und Fremden.
"...Der
Verein zu Nieder-Olm, unter Leitung des Hrn. A. Holzamer, siegend
mit dem dritten Preise. Derselbe hätte vielleicht mit seinem
"Nocturno" von Blum und seinem "Studentengruß"
von Berner sich noch höher in die Gunst der Richter emporgeschwungen,
wenn sein Chor stärker und die Aussprache etwas besser gewesen
wäre..."
In den ersten Jahren nach der Gründung
wurde eine Vereinsfahne geweiht. Leider fehlen im Vereinsarchiv
jegliche Unterlagen darüber, da die Protokollbücher aus
dieser Zeit abhanden gekommen sind. Falls diese Unterlagen irgendwann
aufgefunden werden, wären sie für das Vereinsarchiv eine
große Bereicherung. |
1892 |
50jähriges
Jubiläum mit der Weihe einer neuen Fahne am 26. und 27. Juni
1892, das im Hof des Ehrenvorsitzenden Anton Sieben festlich begangen
wurde.
Festrede des 1. Vorsitzenden Peter Ambach
anläßlich des 50jährigen Jubiläums, im Jahre
1892.
"Verehrte Festgenossen,
werthe Damen, liebe Herren!
>>Wo man singt, da laß
dich ruhig nieder<<, und >>Singe wem Gesang gegeben<<
das waren wohl die deutschen Dichterstimmen, von denen begeistert,
heute vor 50 Jahren eine Reihe gesangeskundiger Männer unserer
Gemeinde Nieder-Olm zusammentraten, um einen Verein zu gründen
zur Pflege der edlen Sangeskunst. Leider ist es den Gründern
des Vereins, ich nenne hier nur den ersten langjährigen Präsidenten,
Herrn Rudolph Schwarz, der selbst ein Meister des Gesangs gewesen,
den ersten so verdienstvollen Dirigenten Herrn Lehrer Holzamer,
die Herren Pfarrer Greipp, Conrad Seibert und Anton Ambach, ich
sage: leider ist es diesen Männern außer dem letztgenannten
Herrn Anton Ambach nicht mehr vergönnt theilzunehmen an unserem
heutigen Jubelfeste, dem fünfzigjährigen Bestehen des
von ihnen ins Leben gerufenen Vereins. Wohl aber hatten sie alle
das Glück zu sehen, wie der von ihnen gegründete junge
Verein aufblühte und gedieh, wie in ihrem Kreise die edle Sangeskunst
eine wahre Heimstätte gefunden. Allüberall in allen Konzerten,
auf allen Sängerfesten, wo selbst der junge Verein seine Weisen
und Lieder erschallen ließ, wo sich das von hiesigen Frauen
und Jungfrauen schon nach wenigen Jahren gestiftete Vereinsbanner
entfaltete, allüberall war es dem Verein vergönnt Lob
und Anerkennung zu ernten, sich Lorbeer und Palme des Gesanges zu
erringen.
Zu allen seinen Triumphen wehte dem Verein seine Fahne
voran, die - in Ehren alt geworden - heute dem neuen Banner weichen
muß; Möge ihm ein gleiches schönes Schicksal beschieden
sein, möge auch das neue Banner nun das Wachsen und Gedeihen
des Vereins erschauen und den Verein in friedlichem Sangeswettstreite
zu neuen Triumphen geleiten.
Mit diesem unser aller Wunsche
falle denn Hülle des neuen Banners und flattere Fahne einer
schönen glücklichen Zukunft entgegen unter unserem donnernden
dreifachen Hoch für das Weiterblühen des Vereins; der
Nieder-Olmer Gesangverein hoch, nochmals hoch und abermals hoch!" |
1908 |
Aber wie wenig,
wie mechanisch, wie unzufrieden hier der Gesang gepflegt wurde zeigt,
daß nach Verlauf von 66 Jahren ein zweiter Gesangverein mit
dem Namen "Liederkranz" sich konstituierte. Der Gesangverein
"Liederkranz" wurde am 16. Februar 1908 im Lokal von Herrn
Johann Mertens gegründet. Den Anlaß zur Bildung eines
neuen Vereins gaben Unzufriedenheiten und Auseinandersetzungen in
dem "Männergesangverein 1842", wobei fünf Sängern
der Ausschluß aus dem Verein erklärt wurde.
Es waren
dies die Herren: Georg Barber, Michael Debo, Adam Heyer, Josef Heyer
und Anton Schreiber. Gerade diese fünf Herren haben die Gründung
eines zweiten Gesangvereins vorangetrieben. Sei es aus Liebe zum
Gesang oder war es die schwere Beleidigung, die ihnen zugefügt
wurde. Sie ereiferten sich bei der Werbung um neue Vereinsmitglieder,
insbesondere muß hier Georg Barber erwähnt werden, der
sich nicht scheute, mit einer Namensliste von Freund zu Freund zu
eilen, um diese für die neue Sache zu gewinnen. Eifrige Hilfe
erhielten diese fünf Leute sofort in früheren Mitgliedern
des MGV 1842 , die zuvor schon keine Freude und Spaß mehr
hatten, sei es seiner Eintönigkeit und des eigenen Ichs, das
hier so stark obwaltete, daß man bereits bei der ersten Generalversammlung
schon mehrere aktive Mitglieder aus dem MGV 1842 zählen konnte.
Insgesamt waren es 35 aktive Vereinsgründer.
Erster Vorsitzender des "Liederkranz"
wurde Peter Ambach, als Dirigent wurde Lehrer Georg Sander gewählt.
Weitere Vorstandsmitglieder waren: Joh. B. Deuer (2. Vorsitzender),
Georg Frisch (Kassierer), Adam Heyer (Schriftführer), Beiräte:
Simon Mayer, Peter Lohrum, B. Beißmann und Konrad Grode. In
der ersten Generalversammlung wurden die Vereinsstatuten und der
Grabgesang festgelegt. Die Noten hatte jedes Mitglied im ersten
Jahr selbst zu zahlen. Am Jubiläumstag, des Oberlehrer Büchler,
wetteiferte bereits dieser junge Verein mit dem Männergesangverein
1842 und dem evangel. Kirchenchor. Der Anfangsgesang wurde allgemein
als gut bezeichnet. Von der gegnerischen Seite sah man verächtlich
auf den jungen Verein herab und taufte ihn den "Rabattverein". |
1909 |
Neujahr
1909 wurde bereits die erste Probe des Könnens in einem Konzert
abgelegt, wobei auch das Theaterstück "Der Glockenguß
zu Breslau" aufgeführt wurde. Der Dirigent des MGV 1842,
Jakob Sieben, gab den Taktstock an Lehrer Liebmann aus Nackenheim
weiter, der 1889 an die hiesige Volksschule versetzt worden war
und 1920 deren Rektor wurde.
1910 wurde er, aus Krankheitsgründen,
von Jakob Sieben und Georg Sander abwechselnd vertreten.
Lehrer Liebmann führte den Männergesangverein
1842 durch eine stolze Ära, starb aber 1921, 58-jährig,
an einem schweren Leiden. Beide Vereine standen aber keineswegs
in Konkurrenz oder als Rivalen gegenüber, sondern wetteiferten
friedlich nebeneinander. Warum auch sollte keine Eintracht herrschen,
denn letztlich waren die Sänger beider Chöre Söhne
der Gemeinde Nieder-Olm und somit außerhalb des Vereinslebens
Nachbarn und Freunde.
Am 7. Februar feierte der Gesangverein "Liederkranz
1908" sein erstes Stiftungsfest, dabei hatte Dirigent Georg
Sander allen Grund, auf seinen Verein stolz zu sein. Auch ein Damenterzett
hatte sich gebildet und brachte das Stück "Die Kapelle"
vor.
Die Einladungen an den "Liederkranz" waren so
zahlreich, daß sich innerhalb des Vereins eine innere Unruhe
breitmachte, was zur Folge hatte, daß viele die Gesangsstunden
nicht mehr regelmäßig besuchten. Der Dirigent Georg Sander
kaufte übermäßig viele Noten, so daß der Verein
in finanzielle Schwierigkeiten kam. Noch am Tag vor dem 2. Konzert
war alles in schlechter Stimmung. Der Dirigent ging so weit, daß
er dem Verein den Taktstock vor die Füße warf. Aber am
Tag des Konzertes, dem 21. November 1909, war alles vergessen.
Der Unwille, der sich in dem Verein nun einmal eingerissen hatte,
pflanzte sich weiter. Vorstandsmitglieder sind aus dem Vorstand
ausgetreten, Mitglieder sind ausgetreten, und dies alles verursacht
durch das Benehmen des Dirigenten. Sander war nicht mehr der Mann,
der einem Verein vorstehen konnte. Man glaubte schon, in eingeweihten
Kreisen, den Verein als verloren. |
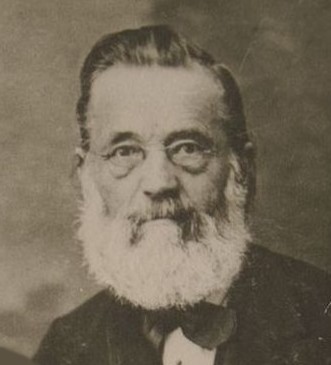 Der
Lehrer Andreas Holzamer, den wir hier im Hinblick auf den Dichter
Wilhelm Holzamer als den Ahn der Familie bezeichnen wollen, ist
am 1. August 1805 noch in Heusenstamm (Kreis Offenbach am Main)
als Sohn eines dort ansässigen Landwirts geboren. Er kam im
Jahre 1834 nach Rheinhessen, als er die katholische Lehrerstelle
in Osthofen (Kreis Worms) antrat. Sieben Jahre später, am 1.
November 1842 wurde er an die zweiklassig gewordene Volksschule
in Nieder-Olm versetzt, und hier beginnt seine Persönlichkeit
über das Einwirken auf seinen Enkel Wilhelm hinaus für
uns greifbar zu werden. -- Andreas Holzamer war nämlich, als
er nach Nieder-Olm kam, bereits das, was man in der historischen
Zeitspanne zwischen dem Hambacher Fest und dem Wirken der Frankfurter
Nationalversammlung "demokratisch eingestallt" zu nennen
pflegte.
Der
Lehrer Andreas Holzamer, den wir hier im Hinblick auf den Dichter
Wilhelm Holzamer als den Ahn der Familie bezeichnen wollen, ist
am 1. August 1805 noch in Heusenstamm (Kreis Offenbach am Main)
als Sohn eines dort ansässigen Landwirts geboren. Er kam im
Jahre 1834 nach Rheinhessen, als er die katholische Lehrerstelle
in Osthofen (Kreis Worms) antrat. Sieben Jahre später, am 1.
November 1842 wurde er an die zweiklassig gewordene Volksschule
in Nieder-Olm versetzt, und hier beginnt seine Persönlichkeit
über das Einwirken auf seinen Enkel Wilhelm hinaus für
uns greifbar zu werden. -- Andreas Holzamer war nämlich, als
er nach Nieder-Olm kam, bereits das, was man in der historischen
Zeitspanne zwischen dem Hambacher Fest und dem Wirken der Frankfurter
Nationalversammlung "demokratisch eingestallt" zu nennen
pflegte.